Was kann der Klimawandel einer Stadt wie La Paz schon anhaben?, fragte ich mich und beantwortete mir die Frage gleich selbst: nichts; es kann eigentlich nur eine gute Nachricht sein. Wenn die Temperaturen steigen, würden kältere Gefilde wie auf dieser Höhe ein paar Grad wärmer werden. Dann würde ich in meiner Stadt mit leichter Kleidung unterwegs sein und nicht in meinem Zwiebellook, der so gar nicht meiner Vorstellung von adrett gekleidet entspricht. Mit dieser Idee im Hinterkopf verbrachte ich die Tage damit, mein Stückchen Garten sorglos zu wässern, mich an kalten Tagen am Holzfeuer zu wärmen und motorisiert zur nächsten Ecke zu gelangen. Soweit zu meinem Beitrag hinsichtlich der Vergeudung begrenzter natürlicher Ressourcen und zur Schädigung der Umwelt.
Meine Beziehung zur Elite des lokalen Umweltaktivismus stammt aus den Studentenjahren. Bei unseren Pasanku-Treffen sprachen wir normalerweise über die Neuigkeiten und Ungeschicktheiten an sämtlichen politischen Fronten sowie die Fehltritte so mancher Journalisten auf dem heute so haarigen Betätigungsfeld, aber nur wenig bis gar nicht über die Nebenwirkungen der globalen Erderwärmung und deren Auswirkungen auf unser Leben. Die hitzigen politischen Umstände verwässern auch auf der informellen Tribüne Themen, die so unverdaulich und so verdächtig sind wie der Klimawandel.
Bis hierher die Geschichte meiner fehlenden Konversion zur Umweltaktivistin. Aber es kam der Tag, oder besser gesagt zwei. Vor ein paar Wochen besuchte ich Cochabamba und Tarija. Ich war acht Jahre nicht in Cochabamba gewesen und was ich an jenen Tagen sah war folgendes: eine feine Staubschicht, die schon aus der Luft wahrzunehmen war, und später, in den Straßen der Stadt, Bäume, deren Wurzeln auf der Suche nach etwas Feuchtigkeit an der Oberfläche verformt waren und traurige, opake Baumkronen ohne frisches Grün. Mein Spaziergang durch den Palacio Portales und seine Parkanlage endete mit Beschwerden über die schlechte Pflege der Gärten. Am Ende, als die Angestellten mir die Situation der Wasserknappheit in jenem Zentrum erklärten – selbst der touristische Palacio Portales verspürt die Auswirkungen- , stand mir der Kopf nicht mehr nach Beschwerden. Es war mir peinlich. Das Wasserproblem in Cochabamba endet jedoch nicht in seinen Gärten, in Wahrheit ist das, um es einmal so zu sagen, der eher oberflächliche Aspekt. Der Wassermangel in einer Stadt, die keine natürlichen Wasserquellen mehr hat, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, hat seine weniger sichtbare – und schlimmere Seite – in alltäglichen Aspekten wie die der persönlichen und häuslichen Hygiene. Ist es in Santa Cruz normal zweimal zu duschen, so ist es in Cochabamba ein Luxus, dies zu tun, wenn man es möchte oder es notwendig ist. Das Normale ist „wenn es eben geht“. Dasselbe gilt für Dinge, die im Hintergrund stehen, wie das tägliche Geschirr spülen oder Wäsche waschen. Eine Kette vieler et cetera, in der die elementarsten Bedürfnisse der jungen und armen Viertel, die einmal pro Woche Wasser in Kanistern erhalten, zum kritischsten und schmerzhaftesten Kapitel werden.
Dem Wasserproblem entkommt in Cochabamba niemand, nicht einmal die auffälligen Wassertanks erlösen die Menschen von der Problematik. Mir wurde erzählt, dass es eine ganze Flut an Nachbarschaftskonflikten gibt – hört sich das nach Ironie an? Einen von diesen löst das Grundwassersystem aus, das traditionell ein großer Trost in Fragen der Wasserversorgung der Stadt war. Zu den ineffizienten Leitungsnetzten, die einen hohen Prozentsatz an Wasserleckagen aufweisen, Wasser, das unterirdisch und auf der Erdoberfläche verloren geht (Verluste, die aufgrund schlechter Leitungen in La Paz und El Alto 2012 bis zu 40% des Trinkwassers verlorengehen ließen), kommt noch das Nichtvorhandensein neuer Quellen und die Verzögerung rettender Projekte wie das des Misicuni-Staudamms. Aufgrund des demografischen und wirtschaftlichen Wachstums hat sich die Zahl der Gebäude vervielfacht mit der Konsequenz, dass die individuellen Versorgungsbrunnen entweder von den Neuankömmlingen überstrapaziert oder zwecks Ausweitung des Kanalisationssystems durchbohrt werden. Ich muss hier gar nicht weiter ins Detail gehen, um eine Vorstellung davon zu vermitteln, welcher Art wohl die Qualität des Wassers ist, das hier auf den Tisch kommen kann.
Ah…ich sagte es bereits. Ich war auch in Tarija. Mein Besuch dort erinnerte mich an das Cochabamba vor 8 Jahren, als das Wasserproblem bereits ein abgedroschenes Konversationsthema war, und zwang mich, eine egoistische, für unsere Zeit sehr typische Frage zu stellen: Bei dem Rhythmus, den wir an den Tag legen, wie wird es da La Paz wohl in 20 Jahren ergehen? Jetzt, wo sich die Umweltdiskussionen in dieser Gegend etwas beruhigt haben, jetzt, wo die in diesen Tagen in Marrakesch stattfindende COP 22 so weit weg zu sein scheint, erkläre ich mich selbst im eigenen Land als konvertiert. Sehen um zu glauben. Erleiden um zu fürchten. Apropos, rationieren reimt mit argumentieren. Die ersten post Aktionen in meiner Evolution: den Wasserhahn fest im Auge behalten und die Autoschlüssel an den Nagel hängen. Wer ist dabei?
Teresa Torres-Heuchel
Übersetzung: Antje Linnenberg
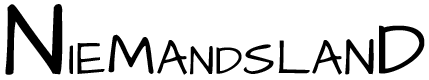

Schreibe einen Kommentar